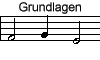|
Zurück zu |
|||
|
|||
|
Der kräftige Schlagton, der bei jedem Klöppelanschlag einer Glocke hervortritt, stellte schon immer ein besonderes Problem dar, wenn es darum ging, ihn physikalisch zu beweisen. Es ist nämlich nicht wie bei den übrigen Teiltönen möglich, dass man den Schlagton zum Mitschwingen, also zu Resonanz anregen kann, wenn man eine Stimmgabel, die auf seine Tonhöhe eingestellt ist, auf die ruhende Glocke aufsetzt. Zwangsläufig folgt daraus, dass er keine eigene Schwingungsform mit Eigenfrequenz besitzt. Wenn bei einer guten Moll-Oktavglocke Prime und Schlagton aufeinanderfallen, mag das Problem des Schlagtons zunächst nicht einleuchten. Man könnte annehmen, dass die Prime durch die harmonischen Obertöne, die ohne Zweifel im Klang vertreten sind, "eine helle und kräftige Klangfarbe erhält, die [...] aufgrund des schnelleren Abklingens der höheren Teiltöne rasch wieder nachlässt." Es gab viele Versuche, den Schlagton und seine Entstehung zu deuten. Die empirische Regel, dass der Schlagton meist genau eine Oktav unterhalb der Oberoktave zu finden ist, wurde von Lord RAYLEIGH schon 1890 aufgestellt und weist darauf hin, dass er kein normaler Einzelton ist, sondern für seine Bildung die höheren Teiltöne verantwortlich sind. Eine Oktaventäuschung bei der OO reicht aber längst nicht als Erklärung aus. Der Versuch, den Schlagton als Differenzton zu erklären, ist ebenfalls nicht ganz unproblematisch. Ein Differenzton wird bei zwei sehr lauten oder tiefen Tönen (Frequenzen f1 und f2) hörbar und entsteht auf die gleiche Weise, wie Schwebungen zu Stande kommen. Bei der Überlagerung von f1 und f2 verstärken und löschen sich deren Amplituden in regelmäßigen Abständen aus. Wie oft dies in einer Sekunde stattfindet, ergibt die Frequenz fD des Differenztons, der im menschlichen Ohr hörbar wird. Dabei gilt: fD = f2 - f1 (-> "Differenz"-Ton). Schwebungen treten bei sehr nahe nebeneinander liegenden Tönen auf, weil hier die Frequenzdifferenz so klein ist, dass sie außerhalb des Hörbereichs des Menschen liegt. Es sind dann nur Lautstärkeschwankungen zu hören. Bei einer Glocke könnte der Schlagton ungefähr ein Differenzton von Duodezime und Oberoktave sein. Einige Tatsachen sprechen aber gegen diese Theorie: Bei vielen Glocken, bei denen die Teiltonfrequenzen von Dd und OO gemessen worden waren, wich die errechnete Differenztonhöhe von der gehörmäßig festgestellten Schlagtonhöhe ab. Außerdem ist ein Differenzton, wie gesagt, nur bei großen Schallintensitäten zu hören, während der Schlagton auch bei einem zarten Anschlag mit dem Hammer am Schlagring der Glocke zu hören ist. Unbestritten ist schon länger, dass das Hören des Schlagtons auf besondere Eigenschaften des menschlichen Ohrs bei der Wahrnehmung von Klängen zurückgeht. Als Erklärung für den Schlagton setzte sich letztendlich durch, dass er als ein sog. Residualton eingeordnet werden muss. J. F. SCHOUTEN veröffentlichte im Jahr 1940 seine gleichnamige Theorie. Als "Residuum" bezeichnete SCHOUTEN eine unvollständige, normalerweise harmonische Obertonreihe, in der die tieferen Harmonischen fehlen. Die Theorie besagt, dass trotzdem ein Ton mit der Grundfrequenz (Residualton) wahrgenommen wird, wenn genügend Harmonische einer Obertonreihe vorhanden sind, obwohl der Grundton und die tiefsten Teiltöne fehlen. Dieser besitzt eine scharfe Klangfarbe. Für das Residualtonhören gibt es auch Beispiele aus unserem täglichen Leben. Obwohl z. B. der kleine Lautsprecher eines Kofferradios nur hohe Frequenzen abgeben kann, hört man bei der Musik trotzdem auch die Bassstimmen heraus, weil genügend Obertöne vorhanden sind, so dass sich die Grundfrequenz im Ohr ergibt. Dasselbe gelingt dem menschlichen Ohr auch beim Telefon. Die gehörte Tonhöhe erklärt mit der gemeinsamen Periode, die ein Verbund von Teiltönen im zeitlichen Verlauf an der Basilarmembran erzeugt. (Die Basilarmembran mit ihren aufgesetzten Härchen ist praktisch die "Schnittstelle" im Innenohr des Menschen zwischen den ankommenden Druckwellen und den Nervenzellen) Was damit gemeint ist, veranschaulicht Abbildung 14 recht gut. Hier ist aufgezeichnet, wie bei einem Modellversuch elf verschiedene Resonatoren (Klangkörper) mit den relativen Eigenfrequenzen 1/2, 19/20, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 7 1/2, 8, 15 1/2 und 16 auf die Erregung durch einen Klang reagieren, der aus der 1. bis 20. Harmonischen besteht. Auf der linken Seite sind die "Reizkurven" aufgetragen, die die Stärke der Erregung durch die einzelnen Harmonischen und deren Frequenzbereich angeben. Man sieht, wie die Amplituden der Resonatorschwingungen davon abhängen, wie groß der Reiz genau bei ihrer Eigenfrequenz ist. Das Besondere an dem Versuch ist, dass im oberen Bereich, wo sich die Reizkurven stark überlappen, die Schwingungen der Resonatoren deutlich periodische Maxima in der Grundfrequenz (die "Periodizität" der Grundfrequenz) zeigen. Durch die Überlagerung aller Resonatorschwingungen entsteht der Eindruck des Residualtons (Abb. 14, unterste Kurve). Im Ohr nimmt allein die Basilarmembran, die an verschiedenen Stellen auf unterschiedliche Erregerfrequenzen reagiert, die Aufgabe der hier verwendeten Resonatoren wahr. |
|||||||
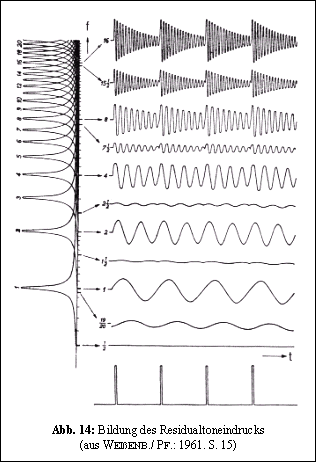 |
|||||||
|
Mit dieser Theorie lassen sich einige Merkmale des Glockenschlagtons sehr gut erklären: zunächst sein schon öfter angesprochener Klangcharakter, der mit dem von Residualtönen gut übereinstimmt, dann die Tatsache, dass er auch bei schwachem Anschlag der Glocke am Schlagring zu hören ist, weil hier die Lauttöner der Glocke mitschwingen, die vor allem Harmonische der Schlagtonfrequenz darstellen und so für die Schlagtonbildung verantwortlich sind, und zuletzt die kurze Dauer des Schlagtons, die daraus resultiert, dass die für seine Existenz wichtigen hohen Glockenteiltöne wegen ihrer relativ starken Dämpfung schnell abklingen. Man darf das Phänomen der Residualtonbildung nicht mit der Bildung von Differenztönen gleichsetzen, weil im ersten Fall eine ganze Reihe von Obertönen vorhanden sein muss (wenn auch nicht vollständig), im anderen Fall genau zwei Töne verantwortlich sind. Die Höhe des Residualtons wird bei Tonreihen, die nicht exakt harmonisch sind, auch besonders von geringen Frequenzabweichungen der untersten vorhandenen Teiltöne beeinflusst. |
|||||||